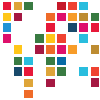Mein Blog wird jetzt von SID angeboten:
Entwicklungspolitik im Überblick SID Hamburg bringt Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis für globale Entwicklung zusammen
- Germanwatch: Nach ersten Erfolgen bei IWF und Weltbank darf keine Reformmüdigkeit eintretenby noreply@blogger.com (Unknown) on 24. April 2024 at 12:12
Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds: Weltbank mit wichtigen Reformfortschritten / Wenig Konkretes beim Internationalen Währungsfonds / Debatte um globale Besteuerung für Superreiche ist allgegenwärtigBonn/Washington (22. Apr. 2024). Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch sieht nach der Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) gemischte Fortschritte in den Reformprozessen. „Die Weltbank hat in den letzten 18 Monaten viel geleistet, abgeschlossen ist der Reformprozess aber noch nicht", erklärt David Ryfisch, Leiter des Bereichs Internationale Klimapolitik bei Germanwatch. „Es darf nach ersten Erfolgen jetzt keine Reformmüdigkeit eintreten. In Anbetracht der sich zuspitzenden globalen Polykrise muss die Dynamik weiter anziehen. Das gilt besonders beim Internationalen Währungsfonds und beim Schuldenabbau. Die Debatte um globale Besteuerung macht immerhin Mut."Weltbank hat weiterhin Luft nach oben Die Weltbank hat die nächsten Meilensteine in ihrer Reformagenda erreicht. Über innovative Finanzinstrumente – wie hybrides Kapital und staatlich abgesicherte Garantien - stehen der Weltbank jetzt über 10 Jahre bis zu 70 Milliarden US-Dollar zusätzlich zur Verfügung. „Deutschland hatte im vergangenen Jahr als erster Anteilseigner hybrides Kapital verwendet. Hiermit hat Deutschland den Weg geebnet, damit auch andere Anteilseigner zusätzliche Beitragsmöglichkeiten nutzen", sagt Anja Gebel, Referentin für Entwicklungsbanken und Klima bei Germanwatch. Die zusätzlichen Gelder sollen hauptsächlich für Länder mit mittlerem Einkommen genutzt werden. „Jetzt darf nicht aus dem Blick geraten, dass auch die Länder mit niedrigstem Einkommen dringend mehr Mittel benötigen. Die Wiederauffüllung der Mittel der für diese Länder zuständigen Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) der Weltbank im Dezember wird zeigen, ob das gelingt", ergänzt Gebel. Fortschritte macht die Weltbank auch in der Zusammenarbeit mit anderen Entwicklungsbanken. Es wurde eine Kofinanzierungsplattform ins Leben gerufen und zukünftig wollen die Banken die Wirkung von Klimaprojekten gemeinsam messen. „Endlich geht die Weltbank die Zusammenarbeit mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken konstruktiv an. Um allerdings wirklich wirksam gemeinsam zu handeln, müssen sich die Banken auch strategisch und analytisch besser koordinieren. Trotz allen Fortschritts ist noch Luft nach oben", so Gebel weiter. Die brasilianische G20-Präsidentschaft lässt weitere Verbesserungsvorschläge ausarbeiten. „Einige Vorschläge der G20-Expertengruppe wurden bislang überhaupt erst ansatzweise diskutiert, geschweige denn umgesetzt. Gerade beim Haftungskapital und dem Dialog mit Kreditratingagenturen muss bis zur Weltbank-Jahrestagung mehr passieren."Reformdebatte beim IWF stockt Weniger Fortschritte gibt es bei der Reform des IWF. Auf die frisch für eine zweite Amtszeit gewählte Direktorin, Kristalina Georgieva, kommt viel Arbeit zu – auch gegen interne Widerstände. Gerade die eskalierende Schuldenkrise in Entwicklungsländern erfordert ein zügiges Handeln. „Der Reformbedarf im IWF bleibt riesig. Bisher sind Klimakomponenten nicht ausreichend abgedeckt", sagt Christian Gröber, Referent für die Reform der Internationale Finanzarchitektur bei Germanwatch. „Deutschland sollte sich für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen IWF und Weltbank beim Klimathema einsetzen. Zudem muss Deutschland seine Blockadehaltung vis-a-vis einer progressiven Nutzung von Sonderziehungsrechten endlich aufgeben. Deren Neuausschüttung und Umverteilung hat zuletzt die Auswirkungen diverser Krisen gelindert."Debatte um Besteuerung Superreicher nimmt Fahrt auf Vorangetrieben durch die brasilianische G20-Präsidentschaft war die Besteuerung Superreicher – zum Beispiel der reichsten 5.000 Menschen global - ein allgegenwärtiges Thema bei der Washingtoner Tagung. Selbst IWF-Direktorin Georgieva sprach sich explizit für eine solche Steuer aus. Sie bot strategische und analytische Unterstützung für eine erfolgreiche Implementierung durch den Fonds an. „Die Bundesregierung wird sich sehr zeitnah zur Besteuerung von Superreichen positionieren müssen – beim Petersberger Klimadialog bietet sich für Kanzler Scholz die Gelegenheit. International koordinierte Abgaben könnten gleichzeitig ein Beitrag zum Abbau von Ungleichheit und zur Finanzierung des globalen Kampfes gegen den Klimawandel in fiskalisch knappen Zeiten sein", meint Ryfisch.
- Weltbank-Frühjahrstagung: Zusätzliche Milliarden für Einsatz gegen Klimawandel und Pandemienby noreply@blogger.com (Unknown) on 24. April 2024 at 12:10
Die Weltbank wird in den kommenden zehn Jahren bis zu 70 Milliarden US-Dollar zusätzlich für den Einsatz gegen Klimawandel, Pandemien und andere globale Aufgaben einsetzen können. Damit ist es gelungen, nach der Einigung auf eine Neuausrichtung der Bank im vergangenen Jahr („better bank") auch zusätzliche Mittel zu organisieren („bigger bank"). Diese sollen gezielt in Projekte fließen, die nicht nur einzelnen Ländern zugutekommen, sondern der ganzen Welt. Das Entwicklungsministerium hatte bereits im vergangenen Herbst 305 Millionen Euro Hybridkapital für die Weltbank zugesagt. Heute haben weitere zehn Staaten entsprechende Zusagen für Hybridkapital beziehungsweise Garantien gemacht, so dass insgesamt 11 Milliarden US-Dollar zusammengekommen sind. Die Weltbank kann mit den neuen Mitteln ein Ausleihvolumen von bis zu 70 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre zur Verfügung stellen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „Von der Weltbank-Frühjahrstagung geht ein starkes Zeichen der Solidarität aus. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Weltbank nicht nur besser zu machen, sondern auch größer. Das bedeutet mehr Geld für den Einsatz gegen die globalen Krisen unserer Zeit. Die frühe deutsche Zusage aus dem vergangenen Herbst hat viele andere Länder zum Mitmachen in ähnlichen Größenordnungen bewegt. Es ist ermutigend, wie gut in der Weltbank selbst in diesen geopolitisch angespannten Zeiten eine konstruktive multilaterale Zusammenarbeit gelingt. Die Weltbank wird künftig besser als je zuvor in der Lage sein, globale Herausforderungen anzugehen." Vor anderthalb Jahren hatte Entwicklungsministerin Schulze als deutsche Weltbank-Gouverneurin gemeinsam mit US-Finanzministerin Janet Yellen eine grundlegende Reform der Weltbank gefordert, die mehr Anreize für Investitionen in globale Aufgaben wie Klimaschutz oder Pandemiebewältigung setzt. Ein Jahr später wurde bei der Weltbank-Tagung in Marrakesch ein neues Leitbild für die Weltbank beschlossen: „A world free of poverty on a livable planet". Damit verbunden war ein echter Richtungswechsel: Armutsbekämpfung und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen gehen nun Hand in Hand. Als erstes Land hatte Deutschland zudem angekündigt, eine reformierte Bank auch mit zusätzlichen Finanzmitteln zu unterstützen. Damit ist die Bundesregierung auf die Forderungen der Entwicklungsländer nach einer größeren Bank eingegangen. Die neuen Finanzmittel sollen gezielt für Anreize wie Zinsvergünstigungen, längere Laufzeiten von Krediten oder höhere Kreditvolumina für Länder mit mittlerem Einkommen verwendet werden, die in globale öffentliche Güter investieren. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass Investitionen in eine elektrifizierte Bahnlinie rentabler werden als der Bau einer Schnellstraße. Oder dass Länder sich für den Aufbau von Laborkapazitäten zur Pandemieprävention entscheiden, von denen letztlich nicht nur das einzelne Land, sondern die ganze Welt profitiert. Vereinbart wurden auch 22 neue Zielindikatoren, mit denen die Weltbankgruppe künftig den Erfolg ihrer Arbeit messen wird. Darin sind auf Initiative Deutschlands auch neue Indikatoren zu Biodiversität und Ungleichheit enthalten. Denn sehr ungleiche Gesellschaften sind verletzlicher und schlechter in der Lage, gemeinsame Problem zu lösen.
- Weltbank und IWF: Reformdruck muss hoch bleibenby noreply@blogger.com (Unknown) on 17. April 2024 at 14:04
Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds: Germanwatch fordert bessere Zusammenarbeit der Weltbank mit anderen Entwicklungsbanken und Bewegung Deutschlands beim Internationalen WährungsfondsBonn/Washington (15. Apr. 2024). Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch fordert vor der Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF), dass die Reform der Institutionen weiter beschleunigt wird. „Beide Institutionen machen höchst unterschiedliche Fortschritte: Während die Weltbank sich in einem Jahr stärker verändert hat als von vielen erwartet, tritt der Internationale Währungsfonds bisher auf der Stelle. Zum anstehenden 80. Geburtstag der Institutionen ist der Reformbedarf größer denn je. Es liegt jetzt an Anteilseignern wie Deutschland, dass sie Reformen weiter mit Nachdruck einfordern", sagt David Ryfisch, Bereichsleiter für Internationale Klimapolitik bei Germanwatch.Weltbank muss stärker im Team spielen Die Weltbank ist ihrem Ziel „größer, besser und kühner" zu werden – so der eigene Slogan - schon einen großen Schritt näher gekommen. Bei der Frühjahrstagung werden noch offene Fragen der Evolutionsagenda abschließend geklärt: Zum Beispiel sollen Strukturen geschaffen werden, um Länder mit mittlerem Einkommen besser bei der Bewältigung der Klimakrise unterstützen zu können. Allerdings sind weitere Reformen nötig. Anja Gebel, Referentin für Entwicklungsbanken und Klima bei Germanwatch: „Die Weltbank muss systematischer mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammenarbeiten. Dadurch kann sie noch deutlich effizienter werden. Deutschland muss gemeinsam mit anderen Anteilseignern die Weltbank dazu bringen, in der Zusammenarbeit hier viel besser zu werden." Weltbank-Beschäftigten fehlten zudem interne Anreize, sich selbst für den Wandel einzusetzen. Deutschland bremst beim Internationalen Währungsfonds Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, wird durch das vielfach kritisierte "Gentlemen's Agreement" – demzufolge die europäischen Anteilseigner immer den Präsidenten oder die Präsidentin des IWF bestimmten dürfen – eine zweite Amtszeit bekommen. Sie hat bereits in ihrer ersten Amtszeit versucht, die Klimaagenda voranzutreiben, hat aber auch aufgrund internen Widerstands und knapper Ressourcen nicht ausreichend Fortschritte gemacht. Christian Gröber, Referent für Reform der Internationalen Finanzarchitektur bei Germanwatch, betont: "Kristalina Georgieva hat den IWF zuletzt durch diverse Krisen geführt und Klimaaspekte besser in die Arbeit des Fonds integriert. Aber der IWF tut noch nicht genug für die Eindämmung der Klimakrise. Deutschland muss Georgieva für ihre Reformbemühungen die nötige Rückendeckung geben, denn die Klimakrise droht die Finanzmarktstabilität massiv zu gefährden." Eine der innovativsten Reformmaßnahmen ist die Weiterleitung der Sonderziehungsrechte – Zugriffsrechte auf einen Korb starker Währungen, darunter US-Dollar und Euro - an multilaterale Entwicklungsbanken. Diese können dadurch mehr Geld für Klimamaßnahmen verleihen. "Deutschland ist in Form der Bundesbank einer der letzten Blockierer. In Zeiten knapper Haushalte wäre die Weiterleitung von Sonderziehungsrechten eine riesige Finanzierung fast zum Nulltarif", so Gröber weiter.Klimafinanzierung nur mit Besteuerung Superreicher zu schaffen Am Rande der Tagung treffen sich auch die G20-Finanzminister:innen. Unter brasilianischer G20-Präsidentschaft werden Diskussionen um die Besteuerung Superreicher unter anderem für die Klimafinanzierung im Fokus stehen. Die wichtige Initiative verfolgt drei zentrale Ziele: Steigerung der öffentlichen Einnahmen durch gezielte Besteuerung der größten Spitzenverdiener, verbesserte Steuergerechtigkeit sowie Ausrichtung auf das Verursacherprinzip, indem Personen mit besonders klimaschädlichen Lebensstilen für die Eindämmung der Klimakrise zur Kasse gebeten werden. „Deutschland sollte sich konstruktiv in G20-Diskussionen um diese zentralen Anpassungen des internationalen Steuersystems einbringen. Da der Bedarf von Finanzierung für Klimaschutz und -anpassung stark steigt und die bisher verfügbaren Haushaltsmittel begrenzt sind, wird es kaum ohne die gezielte Besteuerung Superreicher gehen", erklärt Ryfisch. Gleichzeitig müssen nicht nur Einzelpersonen, sondern auch relevante Branchen in den Blick genommen werden, zum Beispiel in der Schiff- und Luftfahrt. Erstmals treffen sich am Rande der Tagung die Unterhändler der neuen „Arbeitsgruppe zu Internationalen Steuern". „Deutschland sollte diese Gelegenheit nutzen - sei es als Vollmitglied oder zumindest als Beobachter - um den Dialog zu fördern und Fortschritte in diesen wichtigen Bereichen zu erzielen. Dies liegt im Interesse Deutschlands, denn es geht letztlich auch um Fragen des globalen Wettbewerbs", so Ryfisch weiter.
- UN-Leitlinien zum Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt veröffentlichtby noreply@blogger.com (Unknown) on 17. April 2024 at 09:22
Kinderrechtsorganisationen fordern Aufbruch beim Klima- und Umweltschutz Osnabrück/Berlin (ots) Erstmals liegen die UN-Leitlinien zum Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt in deutscher Sprache vor. Zur Veröffentlichung fordern die Kinderrechtsorganisation terre des hommes und das Kinderrechtenetzwerk National Coalition Deutschland von der Bundesregierung entschiedeneres Handeln ein, um die Lebensgrundlagen von Kindern und zukünftigen Generationen weltweit zu schützen. Grundlage der Leitlinien ist die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die auch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziert hat. Der UN-Kinderrechtsausschuss hatte im September 2023 erstmals den sogenannten "General Comment No. 26" vorgelegt, damit ein eigenständiges Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt aus der Konvention abgeleitet und klargestellt: Staaten müssen umgehend und entschieden handeln, um die Erderwärmung zu begrenzen, die Umweltverschmutzung einzudämmen und das Artensterben zu stoppen. Auch aus bestehenden Kinderrechten wie dem Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung folgen weitreichende Verpflichtungen. "Klimawandel und Umweltverschmutzung bedrohen die Rechte von Kindern in einer bisher nie gekannten globalen Größenordnung", so Joshua Hofert, Vorstand Kommunikation und Sprecher von terre des hommes Deutschland, "dem trägt der Kinderrechtsausschuss nun Rechnung und sagt klar: Wenn Staaten nicht umgehend handeln, sind sie für die Folgen verantwortlich - auch jenseits ihrer Grenzen und bis hin zu kommenden Generationen. Gerade eine Industrienation wie Deutschland, die im globalen Vergleich überdurchschnittlich zur Erderwärmung beigetragen hat, muss dieser Verantwortung gerecht werden." terre des hommes und die National Coalition Deutschland wollen dazu in den kommenden Wochen prüfen, inwieweit aus den Leitlinien auch Konsequenzen für konkrete politische Entscheidungen in Deutschland abgeleitet werden können. Mehrere Handlungsempfehlungen legt der General Comment bereits ausdrücklich dar: "Der General Comment No. 26 weist unmissverständlich darauf hin, dass Staaten, die besonders stark für den Klimawandel verantwortlich sind, auch mehr unternehmen müssen, um ihn zu bekämpfen. Die Kinderrechte gelten für alle, aber die Kinder des globalen Südens sind besonders von Umwelt- und Klimaschäden betroffen. Es kann nicht sein, dass sie in Zukunft die Rechnung für unseren CO2-Ausstoß zahlen müssen", so Bianka Pergande, Sprecherin der National Coalition Deutschland. Den Auftakt zur Umsetzung des General Comment in Deutschland macht morgen eine gemeinsame Veranstaltung mit Vertreter*innen der Vereinten Nationen in Berlin. Bei einer Podiumsdiskussion werden unter anderen Velina Todorova, Mitglied des UN-Kinderrechtsausschusses und Maya-Natuk Rohmann Fleischer, Mitglied des Kinderbeirats zum General Comment No. 26, ihre Perspektive auf dessen Umsetzung in Deutschland darlegen. "Wenn es um die Zukunft unseres Planeten geht, sollte es keine Ausreden geben", sagte Rohmann Fleischer im Vorfeld der Veranstaltung, "deshalb müssen die Stimmen von Kindern und Jugendlichen gehört werden, deshalb ist der General Comment so wichtig. Er gibt Regierungen genaue Richtlinien, um insbesondere für Kinder die guten Lebensbedingungen zu schaffen, die sie wirklich verdienen. Kein Kind sollte jemals so leben, wie zu viele bereits heute leben müssen." Der General Comment No. 26 in deutscher Sprache ist abrufbar unter https://kinderrechtekommentare.de/allgemeine-bemerkung-26/ Eine kindgerechte Kurzversion des General Comment gibt es unter https://www.tdh.de/general-comment/
- Weltbank-Frühjahrstagung: Umsetzung der Weltbank-Reform wird konkretby noreply@blogger.com (Unknown) on 17. April 2024 at 09:21
Entwicklungsministerin Schulze und der Parlamentarische Staatssekretär im BMZ, Niels Annen, brechen heute zur Frühjahrstagung der Weltbank in Washington, D.C., auf. Bei der Jahrestagung im vergangenen Herbst hatten sich die Anteilseigner der Weltbank auf eine ambitionierte Reform verständigt, die zu mehr Investitionen in den Klimaschutz und andere globale Entwicklungsziele führen soll („bessere Bank"). Bei der Frühjahrstagung sollen nun wesentliche Umsetzungsschritte beschlossen werden, die diese Reformziele im operativen Geschäft der Bank konkret verankern. Zudem wird erwartet, dass die Reformziele auch mit neuen Mittelzusagen weiterer Anteilseigner unterlegt werden („größere Bank"). Deutschland war hier bereits im vergangenen Jahr mit seiner Zusage vorangegangen. Schulze: „Die gemeinsame Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemieprävention oder auch extreme Ungleichheit muss Teil der DNA der Weltbank werden. Dafür braucht es konkrete, messbare Ziele und die richtigen finanziellen Anreize. Die Weltbank betritt Neuland, wenn sie die wahre, nämlich die weltweite und auch ökologische Kosten-Nutzen-Bilanz von Projekten bewerten will. Ich bin sicher: Nach der Frühjahrstagung wird die Weltbank besser als je zuvor aufgestellt sein, um weltweit zu einer gerechten und nachhaltigen Entwicklung beizutragen." Die Reform der Weltbank hatte Entwicklungsministerin Svenja Schulze als deutsche Gouverneurin der Weltbankgruppe 2022 gemeinsam mit den USA und weiteren Anteilseignern angestoßen. Bei der Jahrestagung im vergangenen Oktober in Marrakesch wurde daraufhin ein neues Leitbild für die Weltbank beschlossen: „A world free of poverty on a livable planet." Damit war ein echter Richtungswechsel verbunden: Armutsbekämpfung auf der einen Seite und der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen auf der anderen Seite sollen fortan Hand in Hand gehen. Um diesen Anspruch ganz konkret im operativen Geschäft der Bank zu verankern, sollen bei der Frühjahrstagung vor allem folgende zwei Umsetzungsschritte verabschiedet werden: Ein neues Ziel- und Indikatorensystem (sogenannte „Scorecard") soll erstmals die gesamte Weltbank-Gruppe auf dieselben Ziele einschwören – und deren Erreichung messbar machen. Es bricht das neue Leitbild der Weltbank herunter auf einzelne konkrete Ziele und Indikatoren, die messen, wie nah die Weltbank diesen Zielen bereits gekommen ist. Es fungiert damit gewissermaßen als Wegweiser der Reformumsetzung. Bereits zur Jahrestagung im Herbst soll zu allen Zielen berichtet werden. Das BMZ setzt sich bei den Verhandlungen insbesondere für neue Indikatoren zum Biodiversitätsschutz, aber auch zu Ungleichheit ein. Denn sehr ungleiche Gesellschaften sind verletzlicher und schlechter in der Lage, gemeinsame Probleme zu lösen. Ein weiteres Herzstück der Reform soll ein neues Anreizsystem für mehr Investitionen in globale öffentliche Güter werden: Finanzierungsanreize wie vergünstigte Zinsen, längere Kreditlaufzeiten oder höhere Darlehenssummen sollen so gesetzt werden, dass Länder mit mittlerem Einkommen verstärkt in Projekte investieren, die nicht nur ihre eigene Entwicklung fördern – sondern der ganzen Welt zugutekommen, weil sie zum Beispiel Treibhausgase einsparen, Regenwald schützen oder Pandemien verhindern können. Wenn beispielsweise ein Land in Laborkapazitäten und technisches Personal investieren will, um bei einem möglichen Krankheitsausbruch schnell reagieren und die Verbreitung bestmöglich eindämmen zu können, profitieren davon auch die Nachbarländer – wenn nicht gar die ganze Welt. Solche Investitionen mit grenzüberschreitendem Nutzen sollen deshalb künftig durch das neue Anreizsystem begünstigt werden. Zum Anreizsystem gehört auch die entsprechende finanzielle Ausstattung. Als erstes Land überhaupt hatte Deutschland bereits im vergangenen September durch den Bundeskanzler beim G20-Gipfel angekündigt, 305 Millionen Euro an sogenanntem Hybridkapital zur Verfügung zu stellen. Die Weltbank könnte mit dieser Summe gehebelt über zehn Jahre bis zu 2,4 Milliarden Euro bereitstellen. Schulze: „Ich habe mich von Anfang an sehr offen dafür gezeigt, die Weltbank durch die Reform nicht nur besser, sondern auch größer zu machen – also „better" und „bigger". Unsere Partner im Globalen Süden erwarten zu Recht mehr Mittel für die Bewältigung der globalen Herausforderungen. Zu einer echten Transformationsbank gehört auch die entsprechende Finanzkraft. Ich erhoffe mir, dass bei der Frühjahrstagung viele weitere Geber dem deutschen Beispiel folgen und substantielle Zusagen machen werden." Die Weltbankgruppe ist der weltweit größte Finanzier für nachhaltige Entwicklung. Sie wurde im Juli 1944 auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen in Bretton Woods (USA) zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gegründet und feiert damit in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Weltbank und IWF sind Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und haben ihren Hauptsitz in Washington D.C. Die Ministertreffen im Rahmen der Frühjahrstagungen von Weltbank und IWF finden zeitgleich vom 17. bis 19. April 2024 statt.
- OECD-Zahlen zur Entwicklungszusammenarbeit: Bundesregierung erreicht internationale Zielmarke nur durch Rechentrickby noreply@blogger.com (Unknown) on 11. April 2024 at 13:23
Oxfam: Bundesregierung erreicht internationale Zielmarke nur durch Rechentrick Geplante Kürzungen 2025 werden zu Einbruch der deutschen Entwicklungshilfe führen, auch Klima-Zusagen sind in Gefahr Berlin, 11. April 2024. Laut den heute von der OECD veröffentlichten Zahlen zur weltweiten Entwicklungszusammenarbeit sinkt die deutsche Entwicklungshilfe-Quote 2023 auf nur noch 0,79 Prozent des Bruttonationaleinkommens (von 0,83 Prozent im Jahr 2022; Gesamtleistungen 2023: 33,63 Milliarden US-Dollar). Die international vereinbarte Zielmarke von 0,7 Prozent erreicht die Bundesregierung dabei nur noch durch Anrechnung der anfallenden Ausgaben für nach Deutschland geflüchtete Menschen. Diese Ausgaben machen fast ein Fünftel der gesamten Mittel aus, damit ist Deutschland der größte Einzelempfänger seiner eigenen Hilfsleistungen. In den kommenden Jahren ist angesichts des geplanten Kahlschlags im Etat des Entwicklungsministeriums massiver Rückgang der deutschen Unterstützung für einkommensschwache Länder zu erwarten. Tobias Hauschild, Leiter des Bereichs Soziale Gerechtigkeit bei Oxfam Deutschland, kommentiert: „Die heute veröffentlichten Zahlen sind schlicht verheerend. Mit den bereits beschlossenen bzw. geplanten massiven Kürzungen bei den deutschen Entwicklungsleistungen in diesem und den kommenden Jahren wird Deutschland seine internationalen Verpflichtungen und die Versprechen des Koalitionsvertrages brechen. Die für die anvisierte feministische Entwicklungspolitik notwendigen Ressourcen werden nicht zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung lässt damit die Menschen in einkommensschwachen Ländern im Stich. Diese kämpfen mit den Folgen von Krieg, Inflation und Klimakrise. Sie brauchen jetzt unsere Unterstützung und Solidarität. Wir erwarten ein klares Machtwort von Bundeskanzler Scholz weitere Kürzungen zu verhindern und Deutschlands weltweiter Verantwortung gerecht zu werden!" Die geplanten Kürzungen werden nach Einschätzung von Oxfam auch dazu führen, dass die Bundesregierung ihre Zusage, die Unterstützung für Klimaschutz und Anpassung an die Klimakatastrophe in einkommensschwachen Ländern bis 2025 auf jährlich mindestens sechs Milliarden Euro anzuheben, nicht halten können wird. Hauschild: „Wenn die Bundesregierung hier Wort bricht, und danach sieht es derzeit aus, dürfte das die mühsam errichtete Vertrauensbasis zwischen den reichen Industrieländern und den einkommensschwachen Ländern unter dem Pariser Klimaabkommen gehörig beschädigen. Das muss unbedingt verhindert werden!" Statt bei der Unterstützung einkommensschwacher Länder zu kürzen, fordert Oxfam die Bundesregierung auf Milliardär*innen und Multimillionär*innen stärker zu besteuern und in die gesellschaftliche Verantwortung nehmen. Laut einer Oxfam-Modellrechnung könnten durch eine Vermögenssteuer für Superreiche und Hochvermögende 85,2 Milliarden Euro in Deutschland pro Jahr generiert werden. BMZ: Deutschland hat 2023 das UN-Finanzierungsziel für Entwicklungszusammenarbeit erreicht Deutschland hat nach vorläufigen Berechnungen der OECD im Jahr 2023 insgesamt 0,79 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für die Unterstützung ärmerer Länder bereitgestellt. Damit erreicht die Bundesrepublik nach 2016, 2020, 2021 und 2022 zum fünften Mal das vereinbarte Ziel der Vereinten Nationen, mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen. Von den insgesamt rund 33,9 Milliarden Euro entfiel ein Anteil von 12,7 Milliarden Euro auf das Engagement des Entwicklungsministeriums. Die endgültigen Zahlen für 2023 wird die OECD voraussichtlich Ende des Jahres veröffentlichen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „0,79 Prozent sind viel Geld, aber auch eine kluge Investition in die Zukunft für ein Land, das 50 Prozent seiner Wirtschaftsleistung mit dem Export verdient. Unser Wohlstand ist auf Weltoffenheit aufgebaut. Darum ist es nicht nur ethisch geboten, sondern auch in unserem Interesse, in die internationale Zusammenarbeit zu investieren. Die Welt steht vor riesigen Herausforderungen: vom weltweiten Klimaschutz über die Unterstützung der Ukraine bis zu den Hilfen für die Länder, die die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Die schwierige Weltlage erfordert derzeit mehr, nicht weniger internationale Zusammenarbeit. Jetzt entschlossen zu handeln, zahlt sich später aus.“ Knapp 20 Prozent der deutschen Entwicklungsleistungen entfallen auf Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Diese zählen gemäß der international vereinbarten Berechnungsmethoden im ersten Jahr nach Ankunft zu den Entwicklungsleistungen. Im Jahr 2023 fallen hier noch die großen Zahlen der aus der Ukraine geflüchteten Menschen ins Gewicht. Insgesamt sind die Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland 2023 um rund 2 Milliarden Euro auf rund 6,6 Milliarden Euro gestiegen. Sie sind damit der wesentliche Faktor hinter den gestiegenen Entwicklungsleistungen. Ohne Berücksichtigung dieser Kosten läge die deutsche ODA-Quote bei 0,64 Prozent. Deutschland liegt mit seinen Entwicklungs-Investitionen gemessen an seiner Wirtschaftskraft hinter Norwegen (1,09 Prozent), Luxemburg (0,99 Prozent) und Schweden (0,91 Prozent) auf Platz vier. In absoluten Zahlen sind die USA der größte Geber. Als global vernetzte Volkswirtschaft ist Deutschland noch stärker als andere darauf angewiesen, belastbare Zugänge und vertrauensvolle Partnerschaften zu pflegen sowie globale Krisen friedlich und auf dem Wege der Zusammenarbeit zu lösen. Zwar sind die Entwicklungsleistungen (Official Development Assistance/ODA) 2023 in absoluten Zahlen von 33,89 auf 33,92 Milliarden Euro leicht gestiegen. Die sogenannte ODA-Quote im Verhältnis zum deutlicher gestiegenen Bruttonationaleinkommen ist jedoch von 0,85 auf 0,79 Prozent gesunken. Von den insgesamt rund 33,9 Milliarden Euro ODA kamen rund 37 Prozent aus dem Haushalt des Bundesentwicklungsministeriums, das die Mittel weltweit in Zusammenarbeit gegen Armut, Hunger oder Klimawandel investiert. Auch aus den Etats des Auswärtigen Amtes (13 Prozent), des Bundeswirtschaftsministeriums (2 Prozent) und anderer Ministerien (insgesamt 9 Prozent) kommen relevante Anteile an der deutschen ODA. Der deutsche Anteil an den Entwicklungsleistungen der Europäischen Union macht 10 Prozent an der deutschen ODA aus. Zu den deutschen ODA-Leistungen zählen zudem Kosten der Bundesländer für die Bereitstellung von Studienplätzen für Studierende aus Entwicklungsländern in Höhe von 1,8 Milliarden Euro (5 Prozent). Mehr Informationen unter www.oecd.org/dac
- Neue FIAN-Studie dokumentiert schwere Menschenrechtsverletzungen durch Bauxitmine in Guineaby noreply@blogger.com (Unknown) on 10. April 2024 at 08:06
In einer heute veröffentlichten Studie stellt die Menschenrechtsorganisation FIAN dar, wie Deutschland durch die Unterstützung der Sangaredi-Mine der Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) in Guinea zu Menschenrechtsverletzungen beiträgt. Die Studie basiert auf einer Recherchereise, während der ein FIAN-Team Interviews in zehn Dörfern im Einzugsgebiet der Mine geführt hat. Die deutsche Regierung hat einen millionenschweren Kredit der ING Di-Ba für den Ausbau der Bauxitmine versichert, um die Versorgung der deutschen Industrie mit Aluminium zu sichern. Auch die Weltbank gehört zu den Kreditgebern. Seit 2016 verstärkt die CBG mit Hilfe von internationalen Krediten den Bauxitabbau in der Nähe der Stadt Sangaredi im Nordwesten Guineas. In der Konzession des Unternehmens liegen 20 Dörfer. „Die Mine hat wesentliche Wasserressourcen sowie das Ackerland der betroffenen Dörfer zerstört und der Bevölkerung dadurch ihre Lebensgrundlage geraubt. Viele Betroffene können sich deswegen nicht mehr ausreichend ernähren", schildert FIAN-Referentin Gertrud Falk die Situation vor Ort. Die CBG sprengt Bauxit aus dem Boden, was große Mengen Staub und Bodenerschütterungen erzeugt. Die Bevölkerung und die Ökosysteme in der Nähe werden dadurch schwerwiegend geschädigt. „Viele Menschen klagen über Atemwegsbeschwerden. Viele Pflanzen verkümmern. Durch die Bodenerschütterungen bekommen Häuserwände Risse und kollabieren mitunter. Tiere laufen davon", ergänzt Falk. „Die Menschenrechte der Betroffenen auf Wasser, Nahrung, Gesundheit und Wohnen werden in großem Ausmaß verletzt." Diese und weitere Menschenrechtsverletzungen sind in der 64-seitigen Studie detailliert dokumentiert.Im internationalen Banken-Konsortium hat die ING Di-Ba der CBG für den Ausbau der Sangaredi-Mine den größten Einzelkredit in Höhe von 248 Millionen Euro beigesteuert. Die Bundesregierung hat den Kredit inklusive Zinsen im Rahmen ihrer Außenwirtschaftsförderung versichert, obwohl Expert*innen dem Projekt zuvor ein sehr hohes Risiko für die Verletzung von Menschenrechten und Umweltschäden attestiert hatte. „Anhand von diesem Kredit wird deutlich, warum der Finanzsektor zur Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen seiner Geldempfänger gezogen werden muss," fordert Falk. Im vergangenen Jahr war durch eine Intervention von FIAN die akute Verschmutzung eines Flusses mit Bauxitschlamm gestoppt worden.Die CBG gehört zu 49 Prozent dem guineischen Staat und zu 51 Prozent dem Unternehmen Halco Mining, das wiederum den drei multinationalen Bergbaukonzernen Alcoa, Rio Tinto und Dadco gehört. Dadco betreibt in Stade die einzige Aluminiumschmelze Deutschlands. Aluminium wird vor allem für den Fahrzeugbau sowie im Energie-, Verpackungs- und Bausektor benötigt. Die Studie beschreibt auch die politische und wirtschaftliche Entwicklung von Guinea sowie die Menschenrechtslage im Land. FIAN richtet konkrete Empfehlungen zum Schutz der Menschenrechte an die deutsche und die guineische Regierung.Die vollständige Studie hier abrufen: https://www.fian.de/wp-content/uploads/2024/04/2024-03-Sangaredi-Broschuere_web.pdf Weitere Informationen zum Sangaredi-Fall: www.fian.de/was-wir-machen/fallarbeit/sangaredi-guinea FIAN Pressemitteilung vom 10.04.2024
- Flasbarth in Peking: China kann viel beitragen für nachhaltige Entwicklung weltweitby noreply@blogger.com (Unknown) on 10. April 2024 at 08:03
China ist bereits seit 2010 kein bilaterales Partnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mehr. Trotzdem ist es wichtig, mit China auch in neuer Rolle in globalen Fragen von Nachhaltigkeit und Entwicklung zusammenzuarbeiten. Denn China ist als Wirtschaftsmacht, als Kreditgeber und als weltweit größter Treibhausgas-Emittent unverzichtbar für die Bewältigung globaler Herausforderungen. Der Staatssekretär für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Jochen Flasbarth tauscht sich daher heute in Peking mit Vertreterinnen und Vertretern der chinesischen Regierung sowie Partnern von Nichtregierungsorganisationen aus. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Zusammenarbeit zum gemeinsamen Schutz von Klima und Natur sowie die Umsetzung entwicklungspolitischer Normen und Standards. Jochen Flasbarth: „China hat sich vom Empfänger von Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit zu einem Land entwickelt, das selbst viel beitragen kann und muss für nachhaltige Entwicklung weltweit. Als Wirtschaftsmacht, als Kreditgeber und als weltweit größter Treibhausgas-Emittent ist China unverzichtbar für die Bewältigung globaler Herausforderungen. China kann und muss deshalb auch globale Verantwortung übernehmen, zum Beispiel bei der internationalen Klimafinanzierung und bei Umschuldungsbemühungen für besonders belastete Entwicklungsländer. Um die Ziele der Weltgemeinschaft zur Bekämpfung von Armut, Hunger, sozialen Ungerechtigkeiten und Pandemien sowie bei der Bekämpfung des Klimawandels und des Naturverlustes zu erreichen, braucht es jetzt dringend eine gemeinsame und weltweite Aufholjagd. Nur mit vereinten internationalen Kräften können wir eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen erreichen." China spielt eine unverzichtbare Rolle bei der Verwirklichung der UN-Nachhaltigkeitsziele und dem Schutz globaler öffentlicher Güter als größte Volkswirtschaft Asiens, als weltweit größter Emittent von Treibhausgasen sowie als wichtiger Kreditgeber für Länder in Afrika und Asien. Deutschland erwartet von China, dass es entsprechend seines wirtschaftlichen und politischen Gewichtes globale Verantwortung übernimmt. Hierzu gehört insbesondere, dass es sich in der Klimapolitik sowie bei Umschuldungsbemühungen in Entwicklungsländern konstruktiv einbringt. Die Zusammenarbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit China konzentriert sich daher darauf, dass beide Länder gemeinsam globale öffentliche Güter wie Wasser, Natur und Wälder und das Klima schützen wollen. Dazu setzen Deutschland und China gemeinsam auch vereinzelte Kooperationen zugunsten von Drittländern um, so zum Beispiel zum Naturschutz in Sambia. Bereits seit 2010 ist China kein Partnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mehr. China verfügt über große wirtschaftliche und technologische Ressourcen. Das Land vergibt selbst Kredite an andere Länder und investiert in Infrastrukturprojekte beispielsweise in Afrika. Deshalb führt das BMZ mit China auch einen Dialog zu Standards und Praktiken in der Entwicklungszusammenarbeit. Zentrale Punkte sind hierbei die Beachtung universeller Werte und internationaler Standards in der Entwicklungszusammenarbeit wie zum Beispiel die Orientierung am Mehrwert für die jeweiligen Partnerländer sowie Transparenz bei Ausschreibungen, Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Als Plattform für die Zusammenarbeit im entwicklungspolitischen Kontext dient das Deutsch-Chinesische Zentrum für nachhaltige Entwicklung in Peking
- Klimaklagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechteby noreply@blogger.com (Unknown) on 10. April 2024 at 07:53
Verstoßen Staaten gegen die Menschenrechte von Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie zu wenig gegen den Klimawandel tun? Mit dieser Frage hat sich heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) beschäftigt und in drei Fällen geurteilt. Dazu Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung PIK: „Mit seiner jüngsten Rechtsprechung hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zur Kernfrage der internationalen Klimapolitik – der Frage nach der Verantwortung – geäußert. Dass das Gericht dem Verein der Schweizer KlimaSeniorinnen Recht gegeben und unzureichende Klimapolitik als menschenrechtsverletzend anerkannt hat, ist bahnbrechend. Dieses Urteil sollte auch andere Staaten an ihre internationalen Verpflichtungen erinnern: Wer sich Klimaziele setzt, ist dafür verantwortlich, diese einzuhalten. Klar ist aber auch, dass Europa das 1,5°C-Ziel alleine nicht halten kann und auch die Schweiz hier nicht alleine die Verantwortung trägt. Das Pariser Klimaabkommen legt globale Ziele, nicht aber verpflichtende Beiträge einzelner Staaten fest. Verantwortlich für die Bekämpfung des Klimawandels ist also die gesamte internationale Staatengemeinschaft – und vor allem sind es die Hauptemittenten. Es braucht daher bindende Mechanismen über Staatsgrenzen hinweg, um Kooperation zu ermöglichen. Ein gelungenes Beispiel dafür ist der Carbon Border Adjustment Mechanism der Europäischen Union, der für nicht-europäische Staaten monetäre Anreize zur Kooperation schafft. Das kann helfen, Kohlenstoffmärkte weiter auszubauen und international zu vernetzen." Dazu auch Johan Rockström, ebenfalls Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung PIK: „Nach mehr als drei Jahren Gerichtsverfahren hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass ein Staat - in diesem Fall die Schweiz - es versäumt hat, angemessen auf die von Menschen verursachte Klimakrise zu reagieren und damit die Menschenrechte seiner Bürger verletzt. Bei diesen Urteilen geht es jedoch nicht nur um einen Staat: Es ist das erste Mal, dass sich ein internationales Gericht zum Klimawandel als Menschenrechtsfrage äußert. Das wird wichtige Auswirkungen für alle Politiker und Politikerinnen, insbesondere für die Regierenden haben. Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände bedrohen schon heute Menschenleben. Mit fortschreitendem Klimawandel nehmen diese Extremwetterereignisse zu. Künftige Generationen sind daher besonders vom Klimawandel bedroht. Regierungen müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um Emissionen zu mindern und schwer vermeidbare CO2-Emissionen durch Negativemissionen auszugleichen. Je stärker wir das CO2-Budget für 1,5°C-Grad überschreiten, desto mehr CO2 muss darüber hinaus durch gezielte Entnahmen abgebaut werden. Klimaklagen können Druck auf Regierungen ausüben, ihre klimapolitischen Anstrengungen zu erhöhen, und damit diplomatische Verhandlungen voranbringen." Zum Hintergrund: Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt hatten der Schweizer Verein der KlimaSeniorinnen und seine Mitglieder, der ehemalige Bürgermeister der französischen Stadt Grande-Synthe Damien Carême sowie eine sechsköpfige Gruppe junger Portugiesinnen und Portugiesen im Alter von zwölf bis 24 Jahren. Die Beschwerden der KlimaSeniorinnen und Damien Carême richteten sich gegen ihre jeweiligen Heimatländer, die Schweiz und Frankreich. Im Falle der portugiesischen Jugendgruppe standen alle 27 Mitgliedsstaaten der EU sowie Großbritannien, Russland, die Türkei, Norwegen und die Schweiz auf der Anklagebank. Damit ist die Klage der Portugiesinnen und Portugiesen weltweit in Bezug auf die Beschwerdegegner die 'größte' bisher verhandelte Klimaklage. Ursprünglich richtete sie sich auch gegen die Ukraine. In Folge des russischen Angriffskrieges hatten die Jugendlichen die Klage gegen das Land jedoch zurückgezogen. In allen drei Fällen beriefen sich die Klägerinnen und Kläger auf ihre Menschenrechte, die sie durch eine ungenügende Klimapolitik der angeklagten Staaten verletzt sahen. Konkret bezogen sie sich dabei auf das Recht auf Leben (Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK) und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 8 EMRK). Die portugiesischen Jugendlichen beriefen sich außerdem auf das Verbot unmenschlicher Behandlung (Artikel 3 EMRK) und das Verbot von Diskriminierung in der Anwendung von Rechten und Freiheiten (Artikel 14 EMRK). Die Staaten, so die Anklage, unternähmen nicht genug, um ihre Verpflichtungen unter dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten und die Erderwärmung auf unter 2°C, möglichst auf 1,5°C zu begrenzen.
- Schuldendienst im Globalen Süden so hoch wie nieby noreply@blogger.com (Unknown) on 10. April 2024 at 07:51
(Berlin/Düsseldorf, 9. April 2024) Die weltweite Schuldenkrise spitzt sich weiter zu: Verschuldete Staaten im Globalen Süden müssen 2024 so viel Schuldendienst wie noch nie an ihre ausländischen Gläubiger leisten. Ein Grund sind fehlende Schuldenerlasse. 130 von 152 untersuchten Ländern weltweit sind kritisch verschuldet, 24 von ihnen sogar sehr kritisch.Dies zeigt der Schuldenreport 2024 von erlassjahr.de und Misereor, der heute im Vorfeld der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank veröffentlicht wurde. Schuldenreport 2024 (PDF)Website "Schuldenkrise" Blogbeitrag: Schuldenreport 2024: „Sturm der Bedrohung“„In 45 Staaten fließen mehr als 15 Prozent der Staatseinnahmen in den Schuldendienst“, erklärt Kristina Rehbein, Politische Koordinatorin des deutschen Entschuldungsbündnisses erlassjahr.de. Pro Tag seien dies mehr als eine Milliarde US-Dollar – so viel wie noch nie. „Unsere Untersuchungen zeigen, dass viele Länder im Globalen Süden deshalb buchstäblich mit dem Rücken zur Wand stehen“, so Rehbein weiter. Dringend notwendige Investitionen in Bildung, Gesundheit und Klimaschutz seien durch den erdrückenden Schuldendienst massiv erschwert. „In Zeiten hoher globaler Zinsen können viele kritisch verschuldete Staaten den hohen Schuldendienst nur noch leisten, wenn sie dafür an anderen Stellen stark einsparen“, mahnt Rehbein. Fehlende Schuldenerlasse gefährden Menschenrechte„Die Ergebnisse aktueller Umschuldungsverhandlungen in kritisch verschuldeten Ländern wie Sambia, Suriname und Sri Lanka zeigen einen gefährlichen Trend: Gläubigerinteressen dominieren, echte Schuldenstreichungen gibt es daher kaum. Es sind die Menschen in den Schuldnerländern, die dafür bezahlen“, mahnt Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei Misereor. Sri Lanka ist hier ein eindrückliches Beispiel. Ahilan Kadirgamar, Professor an der Universität Jaffna in Sri Lanka und einer der Autoren des Schuldenreports, beschreibt die Situation in dem Inselstaat: „Die Bevölkerung in Sri Lanka leidet unter stark gestiegenen Preisen für Energie. Haushalte werden vom Stromnetz abgeklemmt, wenn die Menschen die hohen Preise nicht zahlen können. Die Lebenshaltungskosten haben sich verdoppelt. Öffentliche Infrastruktur soll zum Verkauf angeboten werden, um wieder Geld für den Schuldendienst zu mobilisieren – alles Folgen der von den Gläubigern verlangten Maßnahmen im Kontext der Umschuldung.“Sri Lanka ist kein Einzelfall. „Unsere Analysen zeigen, dass sich mehr als die Hälfte der untersuchten Länder mittlerweile in einer kritischen oder sehr kritischen Verschuldungssituation befindet. Vor Corona waren es nur 37 Prozent“, erklärt Klaus Schilder. „Umfassende Schuldenerlasse könnten einen Ausweg aus der Schuldenkrise bieten. Ohne Schuldenstreichungen rücken die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung für die betroffenen Länder in unerreichbare Ferne“, so Schilder weiter.Jetzt die politischen Weichen stellen2024 ist das Jahr für zukunftsweisende Weichenstellungen: Im Jahr vor der Bundestagswahl stehen wichtige internationale Prozesse an. Beim „UN Summit of the Future“ im September 2024 und den Vorbereitungen für die vierte internationale Entwicklungsfinanzierungskonferenz (FfD4) 2025 kann die Bundesregierung dazu beitragen, dass die Weltgemeinschaft endlich die Weichen für faire Entschuldungsverfahren stellt. „Die Bundesregierung muss jetzt ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erfüllen und sich dort für einen neuen Schuldenmanagementkonsens einsetzen“, so Rehbein. „Dieser kann nicht beim Status Quo verbleiben. Zentraler Maßstab muss sein, dass die Menschenrechte in den Schuldnerländern wieder in den Vordergrund rücken, und nicht die Profitinteressen der Gläubiger.“ Zu den Maßnahmen, die die Bundesregierung noch vor Ende der Legislaturperiode umsetzen sollte, gehöre etwa die Schaffung eines nationalen Gesetzes zur besseren Beteiligung von privaten Gläubigern an Schuldenerleichterungen.Der Schuldenreport, der jährlich vom deutschen Entschuldungsbündnis erlassjahr.de und Misereor herausgegeben wird, analysiert jeweils aktuell die Verschuldungssituation von Ländern im Globalen Süden sowie die Rolle Deutschlands in der internationalen Entschuldungspolitik.Zu dem heute von erlassjahr.de und Misereor veröffentlichten Schuldenreport 2024 erklärt Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „Der Bericht zeigt es deutlich: Die Welt braucht einen neuen internationalen Konsens zum Umgang mit der dramatischen Verschuldung. Statt in die Bildung der Kinder, in ein starkes Gesundheitssystem oder in den Klimaschutz zu investieren, ächzen viele Entwicklungsländer unter einer viel zu hohen Schuldenlast. Die dramatische Überschuldung ist zu einem enormen Entwicklungshindernis für viele Länder geworden. Für die Stabilität der Weltwirtschaft ist das eine tickende Zeitbombe. Eine schnelle und nachhaltige Lösung ist darum nicht nur für die überschuldeten Entwicklungsländer zentral – sondern auch in unserem Interesse. Eine gerechte Lösung der Schuldenproblematik ist nur möglich, wenn sich alle Gläubiger gleichwertig an Schuldenerlassen beteiligen. Mittlerweile ist China zum größten staatlichen Gläubiger armer Länder geworden. Frei werdende Gelder müssen den armen Ländern selbst zugutekommen – und nicht anderen Gläubigern. Das gelingt nur mit internationaler Zusammenarbeit. Neben China gilt es, auch private Gläubiger besser in die Pflicht zu nehmen. Innerhalb der Bundesregierung prüfen wir verschiedene Möglichkeiten, wie das am besten gelingen kann." Weitere Informationen Das von der G20 im Jahr 2020 beschlossene „Gemeinsame Rahmenwerk" zum Umgang mit überschuldeten Entwicklungsländern bindet nun explizit auch China in die Verhandlungen zu Schuldenrestrukturierungen ein – ein großer Fortschritt gegenüber dem Zustand davor. Entwicklungsministerin Schulze betrachtet dieses G20-Rahmenwerk als wichtige Grundlage, auf der perspektivisch auch ein internationales Staateninsolvenzverfahren entwickelt werden kann.
- Globale Fluchtrouten - Überlebenskampf und Solidaritätby noreply@blogger.com (Unknown) on 10. April 2024 at 07:47
Mehr als 380 Menschen sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, verstorben oder gelten als vermisst. Mehr als 14.000 Menschen sind es insgesamt in den letzten fünf Jahren. Ein kaum vorstellbares Ausmaß an Verzweiflung: Viele Menschen sind nach monatelanger oder gar jahrelanger Reise durch die Wüste Nordafrikas erneut kriminellen Schleppern ausgeliefert. Oft steigen sie in überfüllte seeuntüchtige Boote, in der Hoffnung, in Europa ein Leben in Frieden und Sicherheit zu finden. „Niemand flieht freiwillig, und kein Zaun, keine Mauer, kein Meer hält Menschen auf, Sicherheit für sich selbst und die eigene Familie zu finden. Es braucht daher legale Fluchtwege und einen sicheren Zugang zu fairen Asylverfahren", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe. Rekordzahl von Menschen auf der Flucht Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, war noch nie so hoch wie heute: Über 114 Millionen Menschen haben bis September 2023 ihr Zuhause verlassen müssen. Die meisten von ihnen, mehr als 62 Millionen, sind innerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht. Mehr als 36 Millionen Menschen leben als Flüchtlinge in anderen Ländern, die Mehrheit in einem Nachbarland. Unbeachtete Krisen Der Krieg in der Ukraine und der Konflikt in Gaza stehen dabei im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Über andere Konflikte, wie beispielsweise im Sudan, wird kaum berichtet. Doch auch dort haben mittlerweile mehrere Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Ebenso zwingen die Krisen in Syrien, dem Jemen oder der Demokratischen Republik Kongo, um nur einige zu nennen, täglich tausende Menschen zur Flucht. Lebensgefährliche Fluchtrouten In dieser dramatischen Situation gibt es weltweit kaum sichere Fluchtwege. Wer auf der Suche nach Schutz fliehen muss, begibt sich auf gefährlichen Routen erneut in Lebensgefahr. Gegenwärtig ist Solidarität wichtiger als je zuvor, weil das Recht auf Schutz fast überall bedroht ist. In vielen Teilen der Welt sind eine restriktive Flüchtlingspolitik, populistische Stimmungsmache und fremdenfeindliche Rhetorik auf dem Vormarsch. „Das Zurückdrängen von Menschen, die internationalen Schutz suchen, verstößt gegen das internationale und europäische Recht. Dies steht auch in krassem Gegensatz zu den moralischen Werten, auf die Europa zu Recht stolz ist. Alle Menschen, die internationalen Schutz suchen, müssen die Möglichkeit haben, Asyl zu beantragen", sagt Philippe Leclerc, UNHCR-Regionaldirektor für Europa. Der UNHCR unterstützt die Vertriebenen vor Ort entlang vieler Fluchtrouten, verteilt in Notfallsituationen lebensrettende Hilfsgüter, stellt medizinische Versorgung von Flüchtlingen und Vertriebenen bereit. Er hilft bei der Integration in lokale Gemeinden und unterstützt diese bei der Aufnahme von Geflüchteten. Die UNO-Flüchtlingshilfe ist nationaler Partner des UNHCR. Mehr Informationen sowie das aktuelle Magazin der UNO-Flüchtlingshilfe zum Thema Fluchtrouten unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de/hilfe-weltweit/themen/fluchtrouten